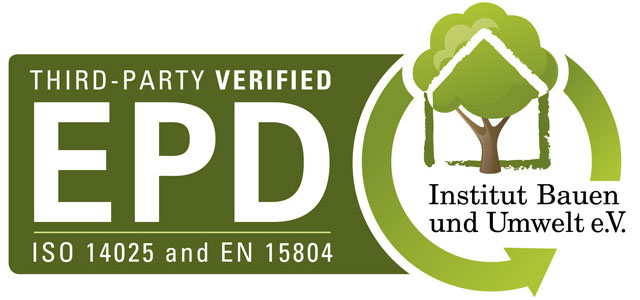Durch die Ausweitung gesellschaftspolitischer Fragestellungen, wie Klima- und Ressourcenschutz, Nachhaltigkeit und Transparenz in der Lieferkette, sind die Anforderungen an die Hersteller von Baustoffen und Bauteilen gestiegen: Sie müssen mehr denn je auf die ökologische Qualität ihrer Produkte achten, deren Wirkung auf die Umwelt ermitteln, die erforderlichen Informationen kommunizieren und das eigene Unternehmen an den neuen Herausforderungen ausrichten.
Die nachfolgende Auswahl möglicher (Zertifizierungs-)Systeme für Betonsteinwerke soll Unternehmen eine Hilfestellung bei der Wahl eines für ihre Zielsetzung geeigneten Systems geben. Dabei kann es je nach Unternehmensspezifika andere – hier nicht genannte – Möglichkeiten geben.
Relevante Systeme für die Betonsteinindustrie
Vor dem Hintergrund des erheblichen arbeitstechnischen und finanziellen Aufwands für Datenerhebung, Bilanzierung und Zertifizierung stehen Unternehmen vor der Herausforderung, das für sie geeignetste System zu finden. Das können im Bedarfsfall auch mehrere sein. Von besonderer Bedeutung für die Wahl des Systems ist die angestrebte Zielgruppe: Endkunde (B2C) oder andere Wirtschaftsakteure (B2B).
Unabhängig von einer gegebenenfalls angestrebten Zertifizierung führt die vertiefte Beschäftigung mit den Umweltwirkungen von Unternehmen und Produkten zu einer Sensibilisierung für die eigenen Prozesse.
Zum Beispiel können
- Kenntnisse über die eigenen Produkte und Produktionsprozesse vergrößert,
- Kosten eingespart werden durch
- effizientere Nutzung von Materialien und Energie,
- effizientere Produktionsverfahren,
- verringertes Abfallaufkommen,
- Innovationen initiiert und
- Umweltauswirkungen reduziert werden.
Umwelt- und Energiemanagementsysteme
Umweltmanagementsysteme (UMS) und Energiemanagementsysteme (EMS) dienen dazu, alle Abläufe und Zuständigkeiten in einem Unternehmen so zu organisieren, dass die eigenen und die gesellschaftlichen Ansprüche an ein umweltverträgliches und energieeffizientes Handeln sichergestellt sind, Chancen und Risiken frühzeitig erkannt und rechtliche Anforderungen erfüllt werden.
Details und weiterführende Informationen:
Überblick – Umwelt- und Energiemanagementsysteme
Grundlagen
-
ISO 14001 Umweltmanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung
-
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
-
ISO 50001 Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung
-
ISO 50005 Energiemanagementsysteme – Leitlinien für eine stufenweise Einführung
Zielgruppe
Wirtschaftsakteure (B2B)
Zertifizierungsebene
-
branchenunabhängig
-
Unternehmen
Nutzen, Besonderheiten
-
ISO 14001: Erfüllung von Anforderungen für CSC-Zertifizierung
-
ISO 50001: Erfüllung von Anforderungen für CSC-Zertifizierung
-
Erfüllung von Pflichten nach Energieeffizienzgesetz
-
Informationen und Organisationsstrukturen für Blauen Engel
Umweltproduktdeklarationen (EPD)
Umweltproduktdeklarationen (EPD engl.: European Product Declaration) enthalten alle Ergebnisse aus einer Ökobilanzierung und ggf. darüberhinausgehende für den jeweiligen Produktbereich relevante Informationen. Durch sie werden umfangreiche verifizierte Umweltinformationen nach einem einheitlichen Standard bereitgestellt.
CO2-Fußabdruck
Sogenannte Footprints beziehen sich in der Regel auf eine einzelne Umwelteigenschaft, wie z. B. das Treibhauspotenzial beim CO2-Fußabdruck oder den tatsächlichen Wasserverbrauch beim Wasserfußabdruck. Über andere Umweltwirkungen werden keine Aussagen getroffen.
Der CO2-Fußabdruck ist ein Maß für die direkten und indirekten CO2-Emissionen. Er kann unternehmensspezifisch als „Corporate Carbon Footprint“ (CCF) oder produktbezogen als „Product Carbon Footprint“ (PCF) erstellt werden.
Soll der CO2-Fußabdruck über eine entsprechende Kennzeichnung kommuniziert werden, ist in der Regel zusätzlich eine externe Zertifizierung erforderlich. Insgesamt ist der Markt der CO2-Labels sehr groß. Sie unterscheiden sich zum Beispiel dadurch, ob die emittierten Treibhausgas (THG)-Emissionen angegeben und geplante Reduktionsziele ausgewiesen oder kompensiert werden.
Als Hilfestellungen bei der Ermittlung des CO2-Fußabdruckes kann die Plattform „Ecocockpit“ der Effizienz-Agentur NRW genutzt werden. Das Tool ist kostenfrei nutzbar und wurde als Hilfestellung „für den produzierenden Mittelstand“ entwickelt.
Details und weiterführende Informationen:
Überblick – CO2-Fußabdruck
Laufzeit, Gültigkeit
Abhängig von den Zertifizierungsanforderungen je Label
Grundlagen
-
ISO 14064-1 und ISO 14064-2 Treibhausgase – Spezifikation mit Anleitung zur quantitativen Bestimmung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen und Entzug von Treibhausgasen Teil 1: auf Organisationsebene und Teil 2: auf Projektebene
-
ISO 14067 Treibhausgase – Carbon Footprint von Produkten – Anforderungen an und Leitlinien für Quantifizierung
-
Greenhouse Gas Protocol (GHG-Protokoll)
-
PAS 2050 Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services
Zielgruppe
-
Endverbraucher
-
Wirtschaftsakteure, v. a. Banken, Investoren
Zertifizierungsebene
-
branchenunabhängig
-
Produkte, Produktgruppen, Unternehmen
Nutzen, Besonderheiten
-
Kommunikation
-
Grundlage für CO2-Zertifikate
-
Informationen für den Blauen Engel
-
Informationen zur Erfüllung von Anforderungen der CSC-Zertifizierung
Der Betonverband SLG bietet die Vermeidungskostenrechner „Pflastersteinfertiger“ und „Plattenfertiger“ an. Mit diesen können SLG-Mitglieder schnell ihren unternehmensspezifischen CO2-Fußabdruck (CCF) ermitteln und diesen unter Einbezug der hinterlegten branchenspezifischen Reduktionsmaßnahmen und deren zugehöriger Investitionsmaßnahmen im Hinblick auf das Kosten-/Nutzenverhältnis bei steigender CO2-Bepreisung steuern.
CSC-Zertifizierung
Ziel der CSC-Zertifizierung sind der Nachweis einer verantwortungsvollen Betonherstellung entlang der Lieferkette und die kontinuierliche Steigerung im nachhaltigen Wirtschaften der Zement-, Gesteinskörnungs- und Betonindustrie. Zertifizierte Werke schaffen damit Transparenz über ihren Herstellungsprozess und dessen Wertschöpfungskette sowie die Auswirkungen ihrer Produkte und Prozesse auf das soziale und ökologische Umfeld.
Eine CSC-Zertifizierung können Betonhersteller und Unternehmen entlang deren Lieferkette erhalten. Für Betonwerke hat die Zertifizierung der Vorkette einen wesentlichen Einfluss auf das Zertifizierungsergebnis. 40 % des CSC-Zertifikates werden durch die Ausgangsstoffe (Zement und Gesteinskörnung) bestimmt.
Weiterführende Informationen:
Überblick – CSC-Zertifizierung
Laufzeit, Gültigkeit
3 Jahre; der Zertifikatsinhaber muss sicherstellen, dass das zum Zeitpunkt der Ausstellung angegebene Leistungsniveau beibehalten wird.
Grundlagen
Systemeigene Dokumentation: Technische Handbücher und Dokumentation
Zielgruppe
Wirtschaftsakteure, v. a. Auftraggeber, ausschreibende Stellen
Zertifizierungsebene
-
Betonindustrie inkl. Vorkette (Gesteinskörnung, Zement)
-
gilt prinzipiell für alle Produkte, die im Werk hergestellt werden
Nutzen, Besonderheiten
-
Kommunikation
-
Erfüllung von Anforderungen aus Ausschreibungen
-
Abdeckung ökologischer, sozialer und ökonomischer Aspekte
-
Erfüllungsstufen: Bronze, Silber, Gold und Platin
-
Anerkannt bei DGNB, BREEAM und LEED
- Kostenloser „Schnellscan“
SPC-Zertifizierung
Die SPC-Zertifizierung ist speziell an der Wertschöpfungskette der Betonfertigteilindustrie ausgerichtet und soll insbesondere kleinen und mittelständischen Firmen die Möglichkeit geben, gegenüber Auftraggebern ihre Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit nachzuweisen. Ziel ist der Nachweis, dass bei der Herstellung der Betonbauteile und ihrer Ausgangsstoffe/-materialien sowohl Anforderungen an die Nachhaltigkeit eingehalten und ein überdurchschnittlicher Beitrag zur Erreichung der nationalen und europäischen Nachhaltigkeitsziele, speziell im ökologischen und sozialen Bereich, geleistet wird.
Sie umfasst Zertifizierungen in den Kategorien Herstellung von Beton, Herstellung von Betonbauteilen sowie Montage von Betonbauteilen.
Details und weiterführende Informationen:
Überblick – Sustainable Precast Zertifizierung (SPC)
Laufzeit, Gültigkeit
Jährliche Überprüfung
Grundlagen
Systemeigene Dokumentation: Zertifizierungssystem, Zertifizierungsprogramm, Leitfaden für Firmen
Zielgruppe
Wirtschaftsakteure, v. a. Auftraggeber, ausschreibende Stellen
Zertifizierungsebene
-
Hersteller von Beton und Betonbauteilen, Montagefirmen für Betonbauteile
-
gilt für alle Produkte, die in einem eigenständigen Produktionsbereich hergestellt werden
Nutzen, Besonderheiten
-
Kommunikation
-
Abdeckung ökologischer, sozialer und ökonomischer Aspekte
-
Erfüllung von Anforderungen aus Ausschreibungen, DGNB-Anerkennung in Vorbereitung
Blauer Engel
Generell werden mit dem Blauen Engel Produkte gekennzeichnet, die – über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus – besondere umweltrelevante Anforderungen erfüllen, d. h. besonders „umweltfreundlich” sind. So soll eine Orientierung beim umweltbewussten Einkauf gegeben werden.
Die Kriterien, die zum Erhalt des Umweltzeichens erfüllt werden müssen (sog. Vergabekriterien), werden vom Umweltbundesamt, dem unabhängigen Beschlussgremium des Blauen Engel (Jury Umweltzeichen) beschlossen. Sie sind je nach Produktbereich sehr unterschiedlich.
Mit den Schwerpunkten Ressourcenschonung und Umweltverträglichkeit gibt es für den Betonbereich den Blauen Engel für Betonwaren mit rezyklierten Gesteinskörnungen für Bodenbeläge im Freien (UZ 216).
Details und weiterführende Informationen:
www.blauer-engel.de/de/blauer-engel/unser-zeichen-fuer-die-umwelt
Überblick – Blauer Engel
Laufzeit, Gültigkeit
Gültigkeitsdauer: entspricht der Laufzeit der aktuellen Vergabekriterien (in der Regel 4 Jahre)
Grundlagen
Vergabekriterien für Betonwaren:
www.blauer-engel.de/de/zertifizierung/vergabekriterien#UZ216-2021Zielgruppe
-
Endverbraucher
-
Wirtschaftsakteure, z. B. ausschreibende Stellen
Zertifizierungsebene
-
branchenspezifisch
-
Produkte
Nutzen, Besonderheiten
-
Kommunikation
-
Vorgesehen für den Produktvergleich
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Außerhalb der Produkt- und Unternehmenszertifizierungen gewinnt die Nachhaltigkeitsberichterstattung (Rechenschaftsbericht eines Unternehmens über Nachhaltigkeitsaspekte) zunehmend an Bedeutung.
Zweck der Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen ist, Transparenz über die nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen für die Geschäftstätigkeit der Unternehmen aber auch über die Auswirkungen eines Unternehmens auf Mensch und Umwelt herzustellen. Die Anforderungen umfassen unter anderem auch Umweltthemen wie Ressourcenverbrauch und klimarelevante Emissionen, gehen jedoch deutlich darüber hinaus.
Zahlreiche Unternehmen aus der Betonsteinindustrie veröffentlichen Nachhaltigkeitsberichte auf freiwilliger Basis. Je nach Unternehmensgröße besteht bereits heute eine gesetzlich verankerte Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (EU-CSR-Richtlinie). Eine Erweiterung der bisherigen Pflichten erfolgt über die Corparate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
Details und weiterführende Informationen:
- Kostenlose Unterstützung für Unternehmen (Deutscher Nachhaltigkeitskodex)
- Corporate Sustainability Reporting Directiv (Informationen der CSR-Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales)
- Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Informationen des Umweltbundesamtes)
- CSR-Self-Check (Angebot der CSR-Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales)
Überblick – Nachhaltigkeitsberichterstattung
Laufzeit, Gültigkeit
Berichtszeitraum: 1 Jahr
Grundlagen
-
EU-Richtlinie zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) – nationale Umsetzung noch offen
-
GRI-Standard
-
Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK)
Zielgruppe
-
Finanzmarkt
-
Wirtschaftsakteure, Investoren
-
Gesetzgeber
Zertifizierungsebene
Unternehmensebene
Nutzen, Besonderheiten
-
Kommunikation
-
Erfüllung von Anforderungen für CSC-Zertifizierung
-
ggf. Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
Ablauf und Aufwand für eine Zertifizierung
Die Wege zur Erlangung einer Zertifizierung mit oder ohne Umweltkennzeichnung sind in den jeweiligen dargestellten Systemen schematisch ähnlich aufgebaut und unterscheiden sich im Wesentlichen in Detailpunkten, der Bezeichnung der einzelnen Akteure oder dem Zeitpunkt der Registrierung des Projektes beim Systembetreiber.
Vereinfachtes Schema zum Ablauf einer Zertifizierung
(abhängig von unternehmensspezifischer Zielsetzung)
(Materialien, Prozesse, Vorkette)
(Validierung der Unterlagen, Prüfung der Nachweise und Dokumente, ggf. Vor-Ort-Termin, Nachbesserung, ggf. zusätzliche Dokumente)
(Ausstellung des Zertifikates, Veröffentlichung)
(Datenaktualisierung, Verbesserungen)
Der Aufwand für die Erlangung eines Zertifikates ist sehr unterschiedlich und variiert in Abhängigkeit vom Zertifizierungsumfang. Neben den monetären Aufwendungen sind vor allem der zeitliche Aufwand für die Zusammenstellung der erforderlichen Daten und Informationen und die Erstellung von Nachweisen und ggf. weiteren Dokumenten teilweise erheblich.
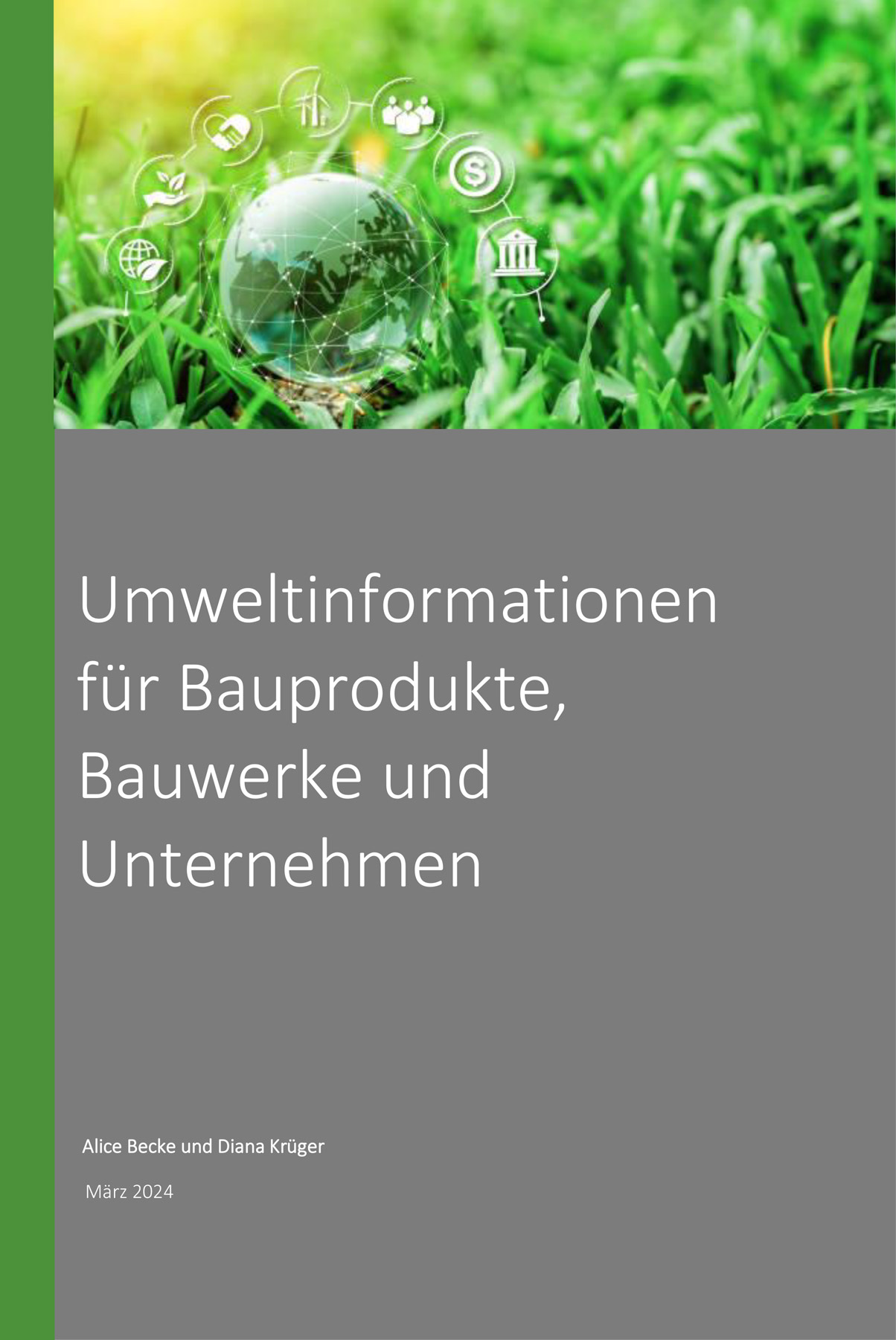
Bei den vorstehenden Texten handelt es sich um inhaltliche Auszüge aus dem Fachbeitrag “Umweltinformationen für Bauprodukte, Bauwerke und Unternehmen - Einordnung für die Betonfertigteilindustrie” der beiden Autorinnen, Alice Becke (Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. / Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V.) und Diana Krüger (Bayerischer Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e.V.). (März 2024)